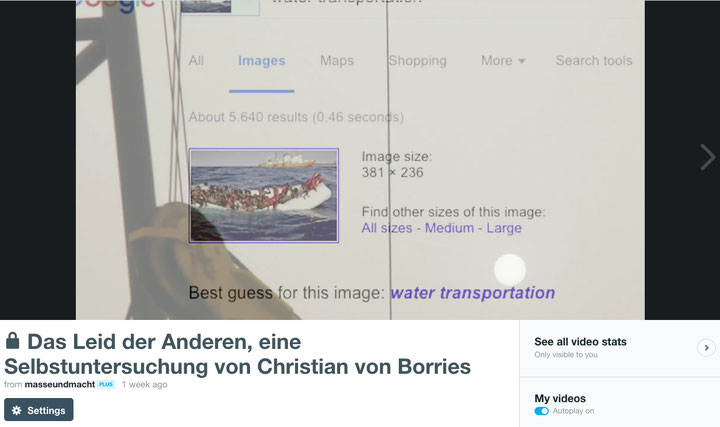Heft 4/2016 - Europe’s Other
„My Kingdom, My Rules“
Ein Gespräch zwischen Christian von Borries, Alice Creischer und Andreas Siekmann
„My Kingdom, My Rules“ heißt die Kennmelodie des Spielfilms The King’s Speech (2010), die auch in einem Fernsehbeitrag von France 2 über Bootsflüchtlinge im Mittelmeer Verwendung fand. Der Journalist, der diesen Bericht lieferte, war letztes Frühjahr Gast auf einem Search-and-Rescue-Schiff vor der Küste Libyens, von wo aus er seine Reportage lieferte. Teil der Besatzung des Schiffes war auch Christian von Borries, der im folgenden Gespräch seine Eindrücke von der Rettungsmission wiedergibt und gemeinsam mit Alice Creischer und Andreas Siekmann die bildpolitische Dimension solcher Unternehmungen bzw. der betreffenden Berichterstattung reflektiert.
Alice Creischer: Christian, du bist zu Beginn dieses Jahres auf einem Flüchtlingsrettungsboot mitgefahren, um beim Bergen von Geflüchteten in Seenot zu helfen. Dort hast du spezielle Erfahrungen in Bezug auf die Herstellung von „Rettungsbildern“ gemacht?
Christian von Borries: Im Frühjahr war ich Teil des Search-and-Rescue-Teams (SAR) auf einem zivilen Rettungsschiff vor der lybischen Küste. Zum einen gibt es auf einem solchen Schiff die Crew, die das Schiff fährt, ein medizinisches Team und dann etwa fünf Leute, die die Rettungen durchführen. Ich war verantwortlich für eines der beiden kleineren, mobilen Rettungsschlauchboote, das dann zum Boot der Schiffbrüchigen fährt. Bald stellte sich heraus, dass es noch ein viertes Team gab. Es war sogar noch größer als die Rettungs- und Ärzteteams und bestand aus professionellen JournalistInnen. Das waren – in meiner dreiwöchigen Zeit an Bord – das staatliche französische Fernsehen, eine Journalistin mit Fotograf von einer französischen Tabloid-Wochenzeitschrift, ein Kriegsfotograf, außerdem noch drei interne Fotografen, einer von den Ärzten beauftragt und zwei von der Organisation, die das Schiff betreibt.
Daraus entstand eine höchst problematische Situation. Die Medienleute waren bei allen vorbereitenden Unterredungen dabei, bei allen medizinischen und die Rettung betreffenden Übungen. Ich merkte auch, dass sie einen jungen Helfer aus dem Rettungsteam zum Protagonisten ihrer Story – ihres Fernsehbeitrags – machen wollten. Das führte dazu, dass die Fokussierung auf die Rettung in diesem Fall wirklich zweitrangig gegenüber der Story wurde. Er war ab da befangen und mit der Vorstellung seines eigenen Bildes im Fernsehen beschäftigt. Mir erschien es aber, als ob nicht nur er plötzlich zum Schauspieler geworden sei, sondern als ob wir alle Darsteller in einem Setting geworden seien, das wie ein Actionfilm angelegt war. Das konnte man unter anderem an der Art sehen, wie sie gefilmt haben, wie sie die Kameras einsetzten, ihre Schwenks, Zooms, Headshots, ihre Anweisungen und ihre Fragen aus dem Off.
Das Fernsehen hatte das Retten von Menschen bereits zuvor als Film konzipiert. Es unterbrach die Rettungsarbeit eigentlich, nicht nur weil es im Weg stand, sondern weil seine Anwesenheit ein theatrales Dreieck produzierte. Dieses Dreieck bestand aus den Schiffbrüchigen, dann den Zuschauenden, die zum Teil helfen und sich zum Teil gegenseitig wieder bei ihrer Hilfe beobachten.
Andreas Siekmann: Wie kann man sich das konkret vorstellen?
von Borries: Man fährt ja von dem großen, 70 Meter langen Schiff aus mit zwei kleinen, schnellen Rettungsbooten zu dem Boot, das in Seenot ist. Wir hatten entschieden, dass es nicht infrage kommt, dass die Medienteams bei dem gefährlichen und schwierigen Erstkontakt mitkamen. Damit haben sie sich nicht abgefunden. Sie wollten nicht einsehen, dass wir die Entstehung von Bildern von Menschen in einer Situation zwischen Leben und Tod verhindern wollten. Wir wollten einfach nicht, dass diese Bilder produziert und reproduziert werden. Wir wollten vermeiden, dass diese Bilder überhaupt gemacht werden, und wurden vom Fernsehen ausgetrickst. Besagtem Kollegen aus dem SAR-Team wurde eine GoPro-Action-Kamera auf den Helm montiert. Die Kamera lief während der ganzen Rettung mit, und ehe wir es bemerkt hatten, war der Chip mit dem gesamten Material wieder in den Händen der Fernsehleute. Wir hatten keine Chance, das zu kontrollieren.
Creischer: Kannst du grundsätzlich etwas zur Situation auf dem Mittelmeer in diesem Frühjahr sagen?
von Borries: Die Route der Fliehenden hat sich seit Anfang 2016 durch den Rückführungsdeal zwischen der Türkei und der EU geändert. Libyen – angeblich stabil nach dem NATO-Krieg – ist das einzige Land, von dem aus die Leute mit den Booten überhaupt noch ablegen können. Von Tunesien oder Marokko aus gelingt das nicht mehr, weil es dort schon Verträge mit der EU gibt, die für das Versiegeln der Küsten bezahlt. Deshalb patrouillieren jetzt vor der libyschen Küste außerhalb der Hoheitsgewässer, also außerhalb der 12-Meilen-Zone, eine ganze Reihe von Schiffen, unter anderem zivilgesellschaftliche, mit Spenden finanzierte Schiffe, wie dasjenige, auf dem ich geholfen habe. Der Großteil der Schiffe sind aber NATO-Kriegsschiffe der EU, die im Auftrag von Frontex patrouillieren und deren oberste Aufgabe die Flüchtlingsabwehr ist. Andererseits verpflichtet internationales Recht jedes Schiff, ein in Seenot geratenes Schiff zu retten. Dieser Maxime folgen auch die Kriegsschiffe. Wir haben es mit einem Verbund von Schiffen vor Ort zu tun, die von einer Koordinierungszentrale aus geleitet werden, dem Maritime Rescue Coordination Center (MRCC) in Rom. Die Koordinierungsstelle in Rom kann genau nachverfolgen, wo sich die zivilen Rettungsschiffe gerade aufhalten, weiß aber nicht, wo die Kriegsschiffe der EU sind, weil diese ihre Satellitenkennung ausgeschaltet lassen.
Siekmann: Die Kriegsschiffe sind also unsichtbar, haben das Monopol über die relevante Information zur Rettung und liefern selbst keine Bilder?
von Borries: Du siehst sie nur am Horizont, weil sie schnell sind. Nach der Rettung verbrennt das Kriegsschiff das, was vom Schlauchboot der Flüchtlinge noch übrig ist, auf dem offenen Meer, eine riesige schwarze Rauchwolke am Horizont. Sie wollen, dass es nicht noch einmal benutzt wird. Das ist das einzige, für alle Beteiligten deutlich sichtbare Zeichen von ihnen, wenn sie nicht gerade Gerettete übergeben oder aufnehmen. Das passiert auch, denn die italienische Küste ist zwei bis drei Tagesreisen weit entfernt, und es fährt immer nur ein volles Schiff die weite Strecke.
Angestellte von Frontex erzählten mir, dass Frontex auch das MRCC, das dem italienischen Innenministerium untersteht, kontrolliert. Das heißt, die zivile Rettung kann nur im Rahmen einer militärischen Operation der EU stattfinden, anders kann man da gar nicht agieren. Das MRCC weiß nicht, wo genau sich die Kriegsschiffe aufhalten. Sie müssen die Kriegsschiffe erst einmal anfunken. Dabei geht wertvolle Zeit verloren. Würden sie sich erkennbar machen, könnten alle Schiffe schneller koordiniert werden.
Creischer: Diese Rettungsschiffe kreuzen also relativ blind vor der 12-Meilen-Zone der libyschen Hoheitsgewässer?
von Borries: Es gibt östlich und westlich von Tripolis zwei große Strände. Von da aus fahren die meisten Boote los. Oft wissen wir, dass das Wetter ein Ablegen der Boote tagelang nicht erlaubt. Sobald sich aber das Meer beruhigt, löst sich der Stau an den Stränden, und dann kann es passieren, dass gleichzeitig mehr als 30 Boote losfahren. Die sind meistens um die zehn Meter lange, einfachste Schlauchboote. So ein Ding kostet etwa 500 Euro. Das kann sich jede/r beim chinesischen Versandhändler Alibaba bestellen, ausgelegt für Ausflugsfahrten auf Binnengewässern, für etwa 20 Personen. Diese Boote sind mit ca. 130 Leuten fünf- bis sechsfach überladen. Sie haben nur einen einfachen Außenbordmotor, können also gar nicht weit fahren und müssen froh sein, wenn sie es überhaupt aus den Hoheitsgewässern heraus schaffen. Selbst wenn ich an alle Hilfsschiffe denke, sagen wir acht Kriegsschiffe und drei Zivilschiffe, dann ist es ausgeschlossen, alle Schiffbrüchigen zu retten. Die UNHCR benennt dieses Jahr wieder mehrere Tausend „verifizierte“ Tote. Aber es gibt eine riesige Dunkelziffer.
Siekmann: Was stellte sich als besonders schwierig heraus bei deiner Arbeit?
von Borries: Die Angst der Menschen beim ersten Kontakt mit uns, das ist keine einfache Situation! Die Menschen, auf die wir trafen, kennen ja meist nur feindliche Begegnungen. Man darf nicht vergessen, dass die Hälfte der Leute, die ihre Heimat Richtung Norden verlassen, schon beim Durchqueren der Sahara oder in libyschen Gefängnissen stirbt. Es gibt Erpressungen, sie werden gefangen und müssen ihre Familien zu Hause kontaktieren und ihre Freilassung mit noch mehr Geld erkaufen. Viele Frauen sind schwanger wegen der Vergewaltigungen unterwegs. Dann werden die Leute mit Waffengewalt nachts auf diese überfüllten Schlauchboote getrieben. Oft sind das die eigenen Leute, die dieses Business generieren. Zu behaupten, es gäbe eine böse Mafia, verkennt die Situation Hunderttausender und die Tatsache, dass sich aus jeder erdenklichen Notlage immer ein Business ergibt und nicht ein moralisches Problem.
Man kann sich ja kaum eine größere Not vorstellen als die Angst vor dem Tod. Und das ist die Situation der Menschen auf den Booten. Du hast kein Geld, kein Telefon, keinen Pass, keine Schuhe, kannst nicht einschätzen, was als Nächstes passiert: Retten die uns, schicken die uns zurück, oder nehmen sie nur die Kinder und Frauen mit? In den meisten Fällen taucht ein graues Kriegsschiff aus dem Nichts auf mit Kanonen am Bug, da hätte jede/r Angst und würde nicht denken, dass sie mich retten und nach Italien bringen werden.
Von genau dieser Angst werden die Fotos gemacht, und das mit der Begründung: Wir brauchen diese Art von Zeugenschaft, Beweismaterial, um die europäische Öffentlichkeit aufzuwecken, als Trade-Off, damit die privaten Organisationen eine Spendentätigkeit mobilisieren können, obwohl dadurch gar kein Geld eingenommen wird, belegt durch interne Erhebungen. Nach wie vor kommt das meiste Geld von Großspendern oder von Institutionen. Es sind wirklich Argumente wie ein „haunted castle“, eine Art Zwangsgesteuertheit.
Diese JournalistInnen haben sich als Teil der Rettungsaktion begriffen, perfiderweise. Die haben auch mal Essenspackungen oder Decken verteilt.
Creischer: Wo sind die Berichte erschienen?
von Borries: France 2, ZDF, BBC, jetzt war Arte da, Zeitschriften, Titelgeschichte in der Zeit1.
Siekmann: Du sprachst am Anfang von einem Setting, das sich ja scheinbar immer wieder reproduziert. Ein Kamerateam nach dem anderen kommt, begehrt diese Bilder, aufgeladen mit einer Authentizität, auch mit einer Vitalität, die von den Flüchtlingen in ihrer Notsituation unwillkürlich geliefert wird.
von Borries: Mich erinnerte das an die Schlüsselszene im Hollywoodfilm, die Situation zwischen Überleben und Tod. Auf einem Rettungsschiff kannst du dir sicher sein, dass du das erleben wirst, und wenn jemand stirbt, hast du sogar den echten Tod im Kasten! Auf einem Rettungsschiff verpasst du das nicht. Später kam dann eine deutsche Fernsehjournalistin an Bord, die sich nach einer Rettungsaktion selbst filmte, wie sie weinte, ganz bürgerliches Theater, Katharsis.
Bei der Rettung kann die Situation katastrophal werden, weil die Wellen hoch sind, weil vor dir Leute ins Wasser springen aus Todesangst, und genau dann entstehen diese Bilder, geschossen von einem Fotografen, der auf dem Rettungsschlauchboot mitgefahren ist, und vor ihm gehen Menschen im Wasser unter. Und dann wärst du wirklich Zeuge eines Verbrechens und keiner humanitären Aktion, nämlich einer unterlassenen Hilfeleistung vonseiten des Fotografen, der seine Hand an der Kamera hat und nicht nach den Händen im Wasser greift. Warum – diese Frage stellt das Foto selbst – ist der Platz nicht frei für einen Geretteten?
Siekmann: Das war ja auch ein klassisches Dilemma der Kriegs- und Katastrophenfotografie, zu dokumentieren und nicht einzugreifen – immer gerechtfertigt mit dem Mandat, Dokumente herzustellen, ZeugIn zu sein.
von Borries: In Zeiten, in denen alle einen Fotoapparat im Telefon haben, ist dieses Mandat doch hinfällig. Viele Beteiligte haben schon während der Rettungen Fotos auf Twitter, Instagram und Facebook hochgeladen. Schließlich gab es strenge Regeln, weil diese „Veröffentlichungen“ schließlich nicht abgesprochen waren, was in welcher Reihenfolge zu veröffentlichen sei. Diese Hierarchisierung der Sichtbarkeit betraf natürlich nicht die eingeladenen externen Staatsmedien. Die Bilder unterscheiden sich also nur noch durch ihre unterschiedlichen Medienoutlets.
Siekmann: Aber wenn die Bilder so gleich sind, dann drückt sich in ihnen vielleicht auch eine Art Common Sense aus, der ein politisches Versagen oder besser, eine politische Indifferenz durch humanitäre Bilder überbrückt. Du sprachst von den Kriegsschiffen und wie sie sozusagen Herr ihrer Sichtbarkeit sind. Zugleich lassen sie in ihrer angeordneten Passivität das Sterben ja zu, sie kreuzen auf dem Meer so indifferent wie die Politik der EU-Staaten, die sich nicht einigen können, nicht nur weil ihnen die populistische Evaluation im Nacken sitzt, sondern auch weil eine Einigung Verpflichtungen nach sich zöge, die in einem einklagbaren Rechtsstatus enden könnten.
Diese Bilder sind Belastungsprobe und Beruhigung in einem. Würde es die nicht-staatlichen Aktionen und die Bilder nicht geben, dann müsste sich eine ungeheure politische Schuld auftürmen. Und deswegen hören die Bilder auch nie auf. Sie rauschen, sie sagen: Ruhig bleiben, statistisches Glück erleben, es wird etwas getan!
von Borries: Keines der Bilder stellt Zusammenhänge her. Sie wiederholen stattdessen sehr alte Klischees. Wenn du diese Bilder zum Beispiel mit Bildern vom Attentat in Nizza vergleichst, dann siehst du dort kaum einen Toten. Weiße Menschen gibt es nicht als Tote. Aber die AfrikanerInnen müssen nackt sein, die müssen angsterfüllte Augen haben. Sie müssen – wie die Headline der Zeit den Leiter der Rettung zitiert – schreien, stinken und zittern.2 Hier werden, verrückterweise in bester Absicht, rassistische und chauvinistische koloniale Bildlegenden reproduziert, von denen man glaubte, dass sie nicht zuletzt durch die Charta von Rom, ein Code of Conduct für den Journalismus, längst überwunden sind.3 Dieser Philorassismus ist vielleicht ein neues Phänomen der Gegenwart angesichts einer indifferent machenden Bilderflut und ihrer Kanäle.
Siekmann: Zusammenhänge herzustellen, hieße ebenso oft gestellte Fragen zu wiederholen, warum die Einreise in die EU nicht legal sein kann oder warum sich so viele Leute auf den Weg machen. Diese Fragen wiederholen sich genau so oft wie die Bilder.
von Borries: Auf dem Schiff stellt niemand diese Fragen: Schlauchboot oder Flug, Fährdienst von der libyschen Küste. Alle, das Militär, aber auch die privaten Rettungsschiffe schweigen dazu, sie intervenieren sogar in ihren Blogs, um keine Zusammenhänge oder politische Aussagen zu treffen. Es bleibt bei diesen Bildwiederholungen und dieser Abstumpfung. Jeder Bereich der Gesellschaft hat schon seinen Beitrag dazu geliefert – ob Schwimmwesten an Opernhäuser, endlose Brückenbaupläne fürs Mittelmeer oder theatrale Erpressungsversuche, die Handlungsoptionen in computeranimierten Clips propagieren.
Creischer: Ich möchte noch einmal zurückkommen auf diese Schlüsselszene, Überleben oder Tod. Als Publikum an dieser Szene teilnehmen zu können, macht auch sehr mächtig. Es wurde öfter von einem Theater der Austerität als einer Entsprechung zum Theater der Grausamkeit gesprochen, einer medialen Show von Arbeitslosen, Gefangenen, Flüchtlingen als Objekte der Erniedrigung, als Pornografie, als Schrecken und Lust.
Siekmann: Vorher gab es noch Inklusionstheater: Arbeitslosenshows, wo man am Ende einen befristeten Arbeitsplatz gewinnen konnte. Jetzt hat man Realitydokus, wo es darum geht, was noch zugemutet werden kann.4
von Borries: Die JournalistInnen haben die Geflohenen immer wieder gefragt: Wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an, wenn man es nach Europa geschafft hat? Die Retter wurden gefragt: Wie fühlt es sich an, wenn man vor sich Menschen sterben sieht? Jede Frage war die unendlich wiederholte Emotionalisierung einer 1:1-Situation. Diese Wiederholung gibt es im Hollywoodfilm nicht.
Creischer: Da führen die Filme serialisiert das gerechte Ende auf. Ich glaube, dass dieses Auf-der-Stelle-Treten der Bilder und der Fragen sehr deutlich eine Situation aufzeigt, in der nichts mehr geht. Wir sprachen schon von den Kriegsschiffen und ihrer politischen Indifferenz. Diese Indifferenz agiert mit einer Gewalt ohne legitimatorische Verkleidung. Die EU geriert doch gerade durch die Not, die sie in anderen Ländern hervorruft, jene „migrantischen Ströme“, die sie nicht aufhalten kann. Es gab und gibt die Auffassung, dass diese MigrantInnen eine politische Avantgarde sind. Dann ginge es um eine Avantgarde, die mit jedem weiteren verzweifelten Schritt, wie und wohin die EU zum Beispiel ihre Überproduktionskrise kanalisiert, wächst. Und zugleich wächst die Repression. Wenn Bilder, Fragen, Berichte unendlich wiederholt werden, dann weil sie auf der Stelle treten, weil es keine Lösung gibt.
Siekmann: Und das zeigt sich auch in den Bildern selbst. Sie sind schon so durchexerziert, dass sie keine Metaphern mehr zulassen, keinen Raum zwischen Bild und Bedeutung, nichts, was über die Bilder hinausginge. Nichts als Drohung, kontingentes statistisches Glück. Aber das sind Diziplinaranwendungen – wie das Zuschauen bei Hinrichtungen – und keine Bedeutungen. Flüchtlingskrisenbilder sind wie Bilder von Naturkatastrophen: groß, unbewältigbar, „erhaben“ eben, wo jedes Eingreifen heldenhaft, aber nutzlos angesichts scheinbar neutraler politischer Naturgewalten erscheint. Vielleicht ist dieses „Erhabene“ die eigentliche Ästhetik der politischen Indifferenz.
von Borries: Wenn ich an Schlüsseltexte zur Bilddiskussion wie Susan Sonntags Das Leiden anderer betrachten oder Judith Butlers Frames of War5 denke, dann merke ich, dass das, was wir hier beschreiben, nicht mehr diesen Texten entspricht. Die gehen immer noch vom Schock aus, von der Wirkungsmacht des Einzelbildes. Wir stellen hier das Gegenteil fest, und das hat sowohl etwas mit politischer Gewalt als auch mit der Funktionsweise der Medien zu tun. Ich kann mich erinnern, dass die Fernsehleute in den vielen Diskussionen, die wir hatten, meine Einwände überhaupt nicht verstanden. Sie sagten, dass sie doch seit Jahren genau diese Bilder produzieren! Das war ihr schlagendes Argument. Und was denn bitte eine Alternative dazu wäre, sie können doch nicht filmen, wie das Schiff durchs Meer fährt.
Bei Google Street View in Deutschland ist fast jede dritte Hausfassade unkenntlich gemacht, um die Privatsphäre zu schützen, während die Medien auf diese Menschen gar nicht nah genug draufhalten können. Nicht weil es gruselig ist, sondern weil die Wiederholung eines bestimmten Subjektstandards das ist, was du brauchst für deine Selbstdefinition.
Das Leid der Anderen, eine Selbstuntersuchung
https://vimeo.com/181374454
Passwort: Springerin
1 Caterina Lobenstein, Er hört, wie sie schreien, er sieht, wie sie zittern, er riecht, wie sie stinken, in: Die Zeit, 7. April 2016.
2 Ebd.
3 www.cartadiroma.org
4 „Dass die Armen […] nicht mehr als Klasse gelten, macht es leichter, sie als Einzelne zu hassen. Sie sind der Abfall des Marktes […] und deshalb haben wir jedes Recht, Zuschauer im Theater der Grausamkeit zu sein […] man denke nur an Sendungen wie die Jerry Springer Show, Big Boss oder Big Brother […] Häufig soll das Publikum darüber abstimmen, wer aus dem Rennen fliegt – ein unverkennbares Simulakrum des neoliberalen Marktes. In Spielshows wurden die Armen belohnt; im heutigen Reality TV werden sie zertrampelt.“ (Philip Mirowski, Untote leben länger. Berlin 2015, S. 136ff.) Vgl. auch Loïc Wacquant, Bestrafen der Armen. Opladen/Berlin/Toronto 2013.
5 Susan Sontag, Regarding the Pain of Others. New York 2003 (dt. Das Leiden anderer betrachten. Frankfurt am Main 2005); Judith Butler, Frames of War: When is Life Grievable? London 2009 (dt. Raster des Krieges: Warum wir nicht jedes Leid beklagen. Frankfurt am Main 2010).