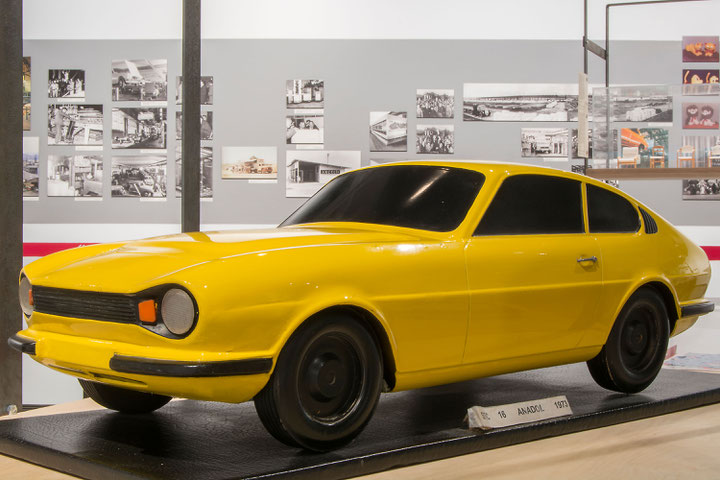Wir verwenden den Begriff des „Postkuratorischen“ schon seit der Eröffnung des SALT Istanbul 2011.1 Die Absicht lag jedoch nie in der Einführung oder Beanspruchung eines hegemonialen Begriffs, unter dem sich viele verschiedene Praktiken zusammenfassen lassen. Vielmehr wollten wir damit eine Art Rückzug markieren, den das SALT angesichts der spektakulären institutionellen Misere der damaligen Zeit anstrebte. Das Postkuratorische war eher als Konnotation gedacht denn als offizieller Fahrplan und sollte ganz sicher nicht für sämtliche Praktiken gelten. Es bedeutete eine Abkehr von den KuratorInnen der „Autorenklasse“, die mit Werten handeln, die gemeinhin der Kunstwelt zugeschrieben werden. Im Grunde ist es nicht möglich zu „postkuratieren“, und der Ansatz ist auch nicht ganz neu; bei seinem früheren Auftauchen wurde er jedoch an den Rand gedrängt, auf molekulare Institutionen abgeschoben und als experimentell abgetan. Jüngere Erscheinungsformen fanden bereits Erwähnung in Texten wie „Curators who don’t Curate“ von Kaelen Wilson-Goodie.2
In den fünf Jahren des Bestehens von SALT haben wir unsere Projekte nicht „signiert“ und stattdessen eine Reihe kontextspezifischer Begriffe wie visualisierende Recherche, Programmierung oder KünstlerIn/ForscherIn verwendet. All diese Ausdrücke deuten, eher unpassend, ganz bestimmte Auseinandersetzungsweisen mit einem Projekt an, von dem wir häufig nicht wussten, wie wir es ausrichten sollten, sei es in Form einer Ausstellung, einer Website, einer Diskussion, eines Buches oder aber als Forschung und Archivierung. In der Zwischenzeit wollen Ausstellungsräume gefüllt werden, und es tat sich meist eine Kluft auf zwischen dem „Ausstellungsreflex“, der darauf angelegt ist, Objekte zusammenzustellen und im Raum anzuordnen, und der Unvorhersagbarkeit des postkuratorischen Ansatzes. Es hat durchaus seine Vorteile, Publikum, NutzerInnen oder die Öffentlichkeit als intelligente Wesen zu behandeln, nur sollte man dabei möglichst konsistent sein.
Gegenwartskunst und Ausstellungen von Gegenwartskunst sind in ihrer institutionalisierten Form auf Wertzuwachs angelegt, ein Kontext, der schon vor der Produktion des Werks und dessen öffentlicher Anerkennung existiert und auf die esoterische Ökonomie von GaleristInnen, HändlerInnen, SammlerInnen und anderen VermittlerInnen zurückzuführen ist. Die Ausstellung an sich ist nur einer der Orte, an denen Kunstwerke an die Öffentlichkeit gelangen; allerdings benötigen Kunstwerke nicht unbedingt ein Publikum, da sie bereits legitimiert wurden, bevor sie die Öffentlichkeit und deren Institutionen erreichen. Was also könnte das Kuratorische antreiben, wenn nicht die Beteiligung an diesem bizarren Martyrium jenseits aller Öffentlichkeit?
Während meiner Arbeit als Direktor des Museums des Center for Curatorial Studies am Bard College vor mehr als 20 Jahren war das Kuratorische noch nicht wirklich bis in die Institutionen vorgedrungen. Bevor die erste Generation der „Post-1989er“ das Feld maßgeblich veränderte, waren GastkuratorInnen einfach nur „Gäste“, die gebeten wurden, ein oder zwei Jahre vor einer Ausstellung eine Liste der auszustellenden Objekte einzureichen. Als etwa zur gleichen Zeit der Chefkurator des MoMA, Kirk Varnedoe, für eine Anzeige von Barney’s im Sonntagsmagazin der New York Times posierte, wies dies auf eine Schwerpunktverlagerung hin, die im Verlauf der nächsten beiden Jahrzehnte zu einem Trend werden sollte. Es war das Zeitalter der KuratorInnen angebrochen, so wie das der Supermodels, ebenfalls in den 1990er-Jahren, gefolgt von DJs, StararchitektInnen und anderen.
Doch zurück in die Gegenwart. In fortschrittlichen Institutionen von heute gibt es eine neue Generation von KuratorInnen, die das Ausstellungsmachen größtenteils nicht als festen Bestandteil ihrer Praxis betrachten. Das Postkuratorische war also immer schon da, auch wenn der Begriff nie als orthodoxer Gedanke verstanden wurde. Die Absicht von SALT bestand nicht darin, ihn als von nun an dominierenden Begriff einzuführen, um so für alle „Neophilen“ einen Bruch für zu signalisieren, sondern vielmehr darin, im Voraus einen Kontext zu artikulieren und das Postkuratorische zur Konnotierung dessen zu verwenden, was wir tun. Wenn dies Auswirkungen auf Ausstellungsinstitutionen hatte und das Bildungswesen darauf anspricht, umso besser, aber das Postkuratorische sollte als eine Art Prototyp verstanden werden und nicht als „Etikett“. Für SALT bedeutet es die Visualisierung von Forschung in einem Kontext, in dem sich unterschiedliche Subjektivitäten um eine Reihe von Fragen, um Neugier und Faszination im Hinblick auf ein vielschichtiges Programm gruppieren. Vielfältige Kenntnisse werden dabei in einer neuen Kapazität assimiliert, um eine kollektive institutionelle Intelligenz zu entwickeln. Dadurch „denaturalisiert“ das Postkuratorische die vermeintliche Autorität der Institution und zielt auf eine andere Realität, um mit deren Elementen zu arbeiten. Es geht nicht allein darum, die Welt zu interpretieren, sondern Teil von ihr zu sein und sich dabei auftretenden Dissonanzen zu stellen. Mag es auch weiterhin hartnäckig um „Programme“ gehen, so doch ohne jede Unfehlbarkeit im Hinblick auf historische Korrekturen.
Als interdisziplinäre, forschungsbasierte und nicht in Abteilungen gegliederte Institution bestand unser Ziel darin, Ideen und Strukturen für Kultur und Gesellschaft mittels breiterer Diskussionen und zusammenhängender Perspektiven zu stimulieren. Durch die Abkoppelung vom Netzwerk der privatisierten Interessen und der Wertbildung konnten wir den Markt auf Abstand halten und ein fokussiertes Experimentierfeld schaffen, ohne zu Brutkästen des Neoliberalismus zu werden. Durch die Behandlung der materiellen Kultur als Wissensinstrument hatte sich SALT von Anfang an vom Kuratorischen gelöst. Die Programme basieren weder auf bestimmten Disziplinen noch auf einzelnen Medien. Auf diese Weise wurden weder kuratorische „AutorInnen“ noch traditionelle Institutionsverwalter anerkannt. Das Ergebnis ist nicht ganz dasselbe, und man könnte meinen, dass wir nicht mehr in der Gegenwartskunst tätig sind, jedenfalls dann, wenn man die Welt nur mithilfe bereichsspezifischer Parameter verstehen kann, etwa von Ausstellungsobjekten, die eindeutig definiert sind durch ihre MacherInnen, die im Rahmen einer ausgewiesenen Kunstinstitution präsentiert werden. Durch die Abschaffung dieser Kategorien mittels postkuratorischer Methoden macht SALT Kunst wieder möglich.
Übersetzung aus dem Englischen: Anja Schulte